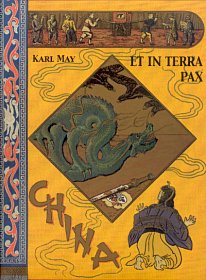Unser Vaterland in Waffen
Wie unpopulär damals pazifistische Gesinnungen waren, mögen zwei Gedichte
dokumentieren:
Seliger Soldatentod
K. Gerok
Schön ist's und süß, den
Heldentod
Für's Vaterland zu sterben,
Mit warmem Herzblut purpurroth
Das Feld der Ehre färben.
Indeß zum Siegeslohne
Ein Engel Kränze flicht:
Es geht durch Kreuz zur Krone
Und geht durch Nacht und Licht!
Und heißt's: Er schläft den letzten Schlaf!
Wohl denk man sein mit Schmerzen,
Das Blei, das ihm zu Tode traf,
Zerreißt daheim zehn Herzen;
Doch wein' ob deinem Sohne,
O Mutter, trostlos nicht:
Es geht durch Kreuz zur Krone
Und geht durch Nacht und Licht!
|
Und liegt ein Held verlassen da
Auf blutbenetzem Grunde,
So sind ihm Gottes Engel nah
Im Kampf der letzten Stunde.
Er hebt zum Gnadenthrone
Erblassend sein Gesicht:
Es geht durch Kreuz zur Krone
Und geht durch Nacht und Licht!
Und liegt er ohne Todtenschrein
Im blutgetränkten Bette,
Und schmückt kein Kreuz, kein Leichenstein
Die unbekannte Stätte:
Glaub's, daß er lieblich wohne,
Weil Gottes Wort verspricht
Es geht durch Kreuz zur Krone
Und geht durch Nacht und Licht!
|
Auf, Soldaten!
Hoffmann von Fallersleben
Auf Soldaten!
Große Thaten
Will von uns das Vaterland.
Nicht umsonst sein Ruf ertöne!
Alle seine Söhne,
Sind seine Wehr- und Ehrenstand.
|
Was wir wollen?
Was wir sollen?
Siegesmuthig stets voran!
Tapfer kämpfen, glorreich siegen,
Oder ehrvoll erliegen:
So geziemt's dem braven Mann.
|
Uns're Fahnen
Ernst uns mahnen,
Mahnen uns an die Ehr' und Pflicht;
Daß wir treu sind unseren Eiden,
Trotz Gefahr und Noth und Leiden
Kämpfen, bis das Herz uns bricht. |
Wie anders zeichnet Karl May ein realistisches Bild über das sinnlose
Kriegstreiben in dem Zeitschriftenroman Die
Liebe des Ulanen (1883–1885). Es werden düsteren Ereignisse des
deutsch-französische Krieges 1870/71 geschildert. May lässt keine
Siegesstimmung aufkommen, kein Hurra nach der gewonnenen Schlacht:
Das Schlachtfeld, über welches die Beiden
nun ritten, war ein solches, wie es selbst die Ebene von Leipzig
nicht aufzuweisen hat, ein breit gedehntes, wellenförmiges
Hochplateau. Man sah es, daß es nicht eine Schlacht, sondern ein
Schlachten gewesen war.
Der Kampf hatte die Spuren einer wahrhaft
grauenvollen Vernichtung hinterlassen. Die Felder waren mit Leichen
förmlich bedeckt. Weithin schimmerten die rothen Hosen der Feinde,
die weißen Litzen der stolzen, zurückgeworfenen Kaisergarde, die
Helme der französischen Kürassiere. Im Wirbelwinde jagten die weißen
Blätter der französischen Intendanturwagen gleich Mövenschaaren über
das Feld. Die Waffen blitzten weithin im Sonnenglanze; aber die
Hände Derer, welche sie geführt hatten, waren kalt, erstarrt, im
Todeskampfe zusammengeballt. Mit zerfetzter Brust und klaffender
Stirn lagen sie gebrochenen Auges in Schaaren am Boden. Schrittweise
war jede Elle des Landes erkämpft worden. Zerschmetterte Leiber,
Pferdeleichen, zerbrochene Waffen, Tornister, Zeltfetzen, Chassepots
und Faschinenmesser lagen umher. Es war ein so entsetzliches Bild,
wie es selbst Magenta, Solferino und Sadowa nicht geboten hatte. Wie
rother Mohn und blaue Kornblumen leuchteten die bunten Farben der
gefallenen Feinde auf dem Todesfelde, weithin über die Höhen, tief
hinab in die Thäler. Dazwischen die grünen Jacken der Jäger und hier
und da ein umgestürzter Sanitätswagen. Niemand kümmerte sich um die
Leiche eines französischen Generals oder Obersten. Der Gefallene war
ja todt, und im Tode hört jede Subordination auf.
Und in den Dörfern, durch welche die Beiden
ritten, sah es noch viel, viel gräßlicher aus als auf dem offenen
Felde.
So ging es bis in die Gegend südlich von
Hanonville, … [Die Liebe des Ulanen, Dresden 1883–1885, S.
1683] |
Noch lange Zeit nach dem
deutsch-französischen Krieg, im Grunde sogar bis zum Ende des zweiten
Weltkriegs, war stets, wenn man hierzulande über Frankreich sprach, vom
erbitterten Erbfeind die Rede. Zumindest damals, als May ›Die Liebe des
Ulanen‹ schrieb, dürfte er nahezu der Einzige gewesen sein, der in seinen
Werken europäisch dachte. In dem genannten Roman werden sensationelle Ehen
geschlossen: Deutscher heiratet Französin, Franzose heiratet Deutsche! Wie
anders sonst wäre dies zu erklären, wenn May nicht um Frieden und
Aussöhnung bemüht gewesen wäre. Sein grundsätzlicher Standpunkt: »Das
Völkerrecht ist nicht dazu da, den Menschen die Erlaubniß zu geben, in
jedem anderen Lande Thaten zu begehen, welche in ihrer Heimath bestraft
werden.« [Deutsche
Herzen, deutsche Helden, Dresden 1885–1887, S. 1913]
In diesem Sinne verfasste May nach 1900
zunehmend Werke mit deutlich pazifistischer Tendenz. Den Auftakt bildete
eine Veröffentlichung in dem chauvinistischen Sammelwerk ›CHINA.
Schilderungen aus Leben und Geschichte, Krieg und Sieg. Ein Denkmal den
Streitern und der Weltpolitik‹ [Leipzig 1901], das Joseph Kürschner
herausgab. Anlass dieser Publikation war der Boxeraufstand im ›Reich der
Mitte‹. Europäische Mächte versuchten bedenkenlos in ihrem
Expansionsdrang, territoriale Forderungen mit Waffengewalt durchzusetzen.
Dreizehn von den achtzehn Provinzen Chinas sollten annektiert werden.
Radikalste Reaktion auf diese Intervention war der erwähnte Boxeraufstand.
Es handelte sich dabei um Mitglieder eines Geheimbundes, die sich als
Faustkämpfer der Rechtlichkeit und Eintracht bezeichneten. Sie leisteten
erbitterten Widerstand gegen die europäischen Eindringlinge. Höhepunkt war
die gemeinsam von Boxern und chinesischem Militär durchgeführte Belagerung
des Diplomatenviertels in Peking, die 55 Tage andauerte. Am 14. August
1900 gelang schließlich einem internationalen Hilfskorps die Befreiung –
China erlitt eine empfindliche Demütigung.
Joseph Kürschner erwartete nun, Karl
May würde in diesen Hurra-Patriotismus mit einstimmen. Er täuschte sich:
Mays Werk ›Et in terra pax‹ entpuppte sich als Kuckucksei. Im Vorwort
entschuldigte sich der Herausgeber, dass diese Erzählung »einen etwas
anderen Inhalt und Hintergrund« erhalten habe, als er »geplant und
erwartet hatte«. In einer erweiterten Fassung erschien diese Erzählung
drei Jahre später unter dem Titel ›Und Friede auf Erden!‹. May äußerte
sich in einem neu dazugeschriebenen Abschlusskapitel über die
Entstehungsgeschichte:
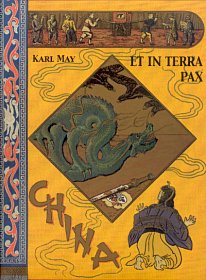 |
»Damals frug ein rühmlichst bekannter,
inzwischen verstorbener Bibliograph bei mir an, ob ich ihm ebenso
wie zu früheren Unternehmungen nun auch zu einem großen Sammelwerk
über China einen erzählenden Beitrag liefern könne. Diese Anfrage
geschah telegraphisch, weil ihm die Sache eilte. Ich zögerte nicht,
ihm ebenso telegraphisch eine bejahende Antwort zu senden, denn ich
hatte vor kurzem »Und Friede auf Erden« zu schreiben begonnen,
hoffte, es schnell zu beenden, und kannte diesen Herrn als einen
Mann, dem ich diese eine, gelegentliche Ausgabe meiner Erzählung gut
und gern überlassen könne. Freilich, hätte er mir mitgeteilt, daß er
mit diesem Sammelwerke eine ganz besondere, ausgesprochen
»abendländische« Tendenz verfolge, so wäre ihm anstatt des Ja
unbedingt ein kurzes Nein geworden.
Da mir nichts Gegenteiliges gesagt wurde,
nahm ich als ganz selbstverständlich an, daß es sich um ein gewiß
unbefangenes, rein geographisches Unternehmen handle, welches nicht
von mir verlange, anstatt bisher nur für die Liebe und den Frieden,
nun plötzlich für den Haß, den Krieg zu schreiben. So erzählte ich
denn ganz unbesorgt, was ich zu erzählen hatte, bis mit einemmal ein
Schrei des Entsetzens zu mir drang, der über mich, das literarische
enfant terrible, ausgestoßen wurde. Ich hatte etwas geradezu
Haarsträubendes geleistet, allerdings ganz ahnungslos: Das Werk war
nämlich der »patriotischen« Verherrlichung des »Sieges« über China
gewidmet, und während ganz Europa unter dem Donner von begeistertem
Hipp, Hipp, Hurra und Vivat erzitterte, hatte ich mein armes,
kleines, dünnes Stimmchen erhoben und voller Angst gebettelt: »Gebt
Liebe nur, gebt Liebe nur allein!« Das war lächerlich; ja, das war
mehr als lächerlich: das war albern. Ich hatte mich und das ganze
Buch blamiert, und wurde bedeutet, einzulenken. Ich tat dies aber
nicht, sondern ich schloß ab, und zwar sofort, mit vollstem Rechte.
Mit dieser Art von Gong habe ich nichts zu tun!« [Und Friede auf
Erden!, Freiburg 1904, S. 490f.] |
Es versteht sich von selbst, dass dieser
Roman im ›Dritten Reich‹ – besonders in den Kriegsjahren – nicht gern
gesehen war. Ein weiteres pazifistisches Werk, Mays ›Ardistan und
Dschinnistan‹, galt als vergriffen.
Die Waffen nieder!
Der Pazifist Karl
May